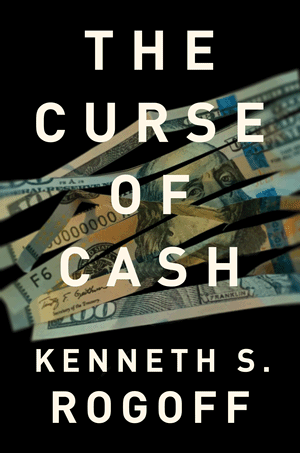Ich hatte meine Chance. Als ich vor zwei Jahren auf einen Zwischenstop nach New York kam, gab es in der Stadt nur einThema: Das Hip-Hop-Musical Hamilton, das alle Regeln der modernen Kunst bricht, sie wider zusammensetzt und niemanden aber auch gar niemanden kalt lässt. Eine Freundin, die fürs Public Theater arbeitet, hatte mir ein Ticket organisiert. Dummerweise hatte ich für den gleichen Abend schon Theaterkarten und zwar für Fish in a Bowl mit Seinfeld-Creator Larry David. Larry konnte ich einfach nicht im Stich lassen und verzichtete auf Hamilton. Ja, ein Fehler, ich weiss…ziemlich ähnlich wie damals 1991, als ich mich für The Wonder Stuff und gegen Nirvana entschieden hatte, als die beide zeitgleich in Boston auftraten (doch das ist eine andere Geschichte).

Zwei Jahre sind vergangen. Seither ist Hamilton die erfolgreichste Broadway-Aufführung aller Zeiten geworden. Karten sind unmöglich zu kriegen und wenn man sie dennoch unbedingt will, dann kosten auf dem Schwarzmarkt noch immer rund 2000 Dollar.
11 Tony-Awards und einen Pulizer-Preis später weiss in Amerika auch das kleinste Kind, wer Alexander Hamilton war. Er war einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, massgeblich an der Verfassung des Landes beteiligt und der grosse Denker hinter dem modernen amerikanischen Finanzsystem – genau der Stoff aus dem erfolgreiche Musicals geschneidert werden.
Diese Mal hatte ich es schon aufgegeben. Weder die Lotterie, irgendeine Ticket-Website noch andere Quellenhatten zum Erfolg geführt. Kein Ticket für Hamilton. Die allerletzte Chance war das gute alte Anstehen. Ich hatte gehört, dass die Leute jeweils um 7 Uhr Morgens schon vor der Tür stehen, um dann um acht Uhr Abends endlich drin zu sein. Fast zufällig liefen wir um kurz vor fünf Uhr Nachmittags am Theater vorbei. Da gab es in der Tat eine Schlange. Doch mehr als 15 Leutestanden zu diesem Zeitpunkt noch nicht an.
Ich stell mich mal dazu. Der Polizist, der aufpasst, dass niemand einen Schwarzmarkt eröffnet, sagt: “Zwischen sieben und 20 Leute kriegen jeweils ein Ticket. Ihr habt eine Chance.” Neben mir tritt die Kulturkritikerin des Guardian nervös von einem Bein aufs andere. Sie steht auch an. “Ich kenne alle Publizisten und für Shows wie Groundhog Day habe ich beste Karten umsonst bekommen. Doch als ich nach Hamilton-Karten fragte, haben sie mich ausgelacht,” sagt sie.
Ich mache es kurz. Bis kurz vor acht lief gar nichts. Dann etwas Bewegung. Die Studenten, die ganz vorne in der Schlange stehen, verzichten auf die ersten Karten, da sie auf die günstigen Stehplätze warten. Nur noch 4 Wartende vor mir. Es schlägt acht Uhr. “Bitte an die Kasse”, sagt der Aufpasser. Ich gehe nach vorne, halte meine Kreditkarte hin und will gar nicht wissen, wie teuer der Platz ist. “Das ist die letzte Karte” sagt die Kassiererin. Wow. Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, kurz vor die Tür zu gehen und die Bad News zu verbreiten. Dann ab in den Saal. Fünfte Reihe mittendrin bei Hamilton.
Vorhang auf:
How does a bastard, orphan, son of a whore and a
Scotsman, dropped in the middle of a forgotten
Spot in the Caribbean by providence, impoverished, in squalor
Grow up to be a hero and a scholar?
Lin-Manuel Miranda heisst das Genie, das die Idee hatte, ein Musical aus der Geschichte dieses Immigranten zu machen, die Rollen mit einem bunten ethnischen Mischmasch zu besetzten, einen Ohrwurm nach dem anderen mit reinzuschmeissen und alles im Hip-Hop-Style zu schreiben. In punkto Musical wohl das Beste, was ich je gesehen habe.
Damit ihr einen kleinen Eindruck erhaltet, worum es geht und warum der Hype so unendlich gross ist, hier ein Video aus dem Jahre 2009, Jahre bevor das Musical fertig war im White House in Washington. Bitte, schaut Euch das an – ich flehe euch an. Da werden die Tränen kullern. Niemand wusste damals, wer Lin-Manuel Miranda war, geschweige denn Alexander Hamilton. Jeder, der sagt, Musicals seinen nichts für ihn und er sei viel zu männlich für sowas – wait and see: