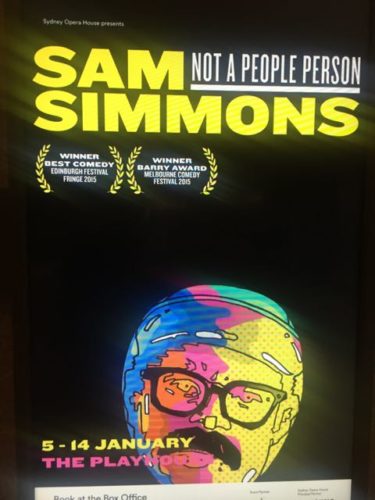Rauf aufs Fahrrad und die Gegend auskundschaften. Besser kann man eine Stadt nicht kennen lernen. Kaum zehn Minuten auf der Strasse höre ich von hinten eine Sirene. Was ist denn nun schon wieder los? Ist da jemand zu schnell gefahren? Die Sirene hört nicht auf und heult mittlerweile direkt hinter mir. Oops, die meinen mich. Was soll ich denn falsch gemacht haben? Ich bin nicht bei rot über die Ampel gefahren, habe signalisiert, dass ich links abbiegen will und fahre auf dem Fahrradweg. Ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Ich halte am Strassenrand an. Im Polizeiwagen sitzen zwei Officer. Sie parken ihr Auto direkt neben mir. Die Polizistin auf dem Beifahrersitz lässt das Fenster runter und sagt: “Hör zu, du hast zwei Optionen. Entweder du bezahlst jetzt gleich 200 Dollar oder Du gehst da rüber ins Fahrradgeschäft und kaufst Dir einen Helm.” Ich bin baff. Einen Helm? Ist der hier Pflicht? “Und ob der hier Pflicht ist”, sagt die Polizistin mit bestimmter Stimme. Ich benutze meinen ganzen Charme und spiele den Touristenjoker. “I am from Switzerland” kam mir wohl noch nie so schnell über die Lippen und mein Schweizer Akzent war schon lange nicht mehr so breit.
Die Polizisten lassen mich ungeschoren davon kommen. Ich stosse das Fahrrad nach Hause, denn dort hat unser Vermieter einen Helm bereitgelegt. Jetzt weiss ich auch warum. Ich kenne keine andere Grossstadt, die Helmpflicht für Fahrradfahrer eingeführt hat. Ich hasse solche Vorschriften. Den Eingriff in die persönliche Freiheit, besonders wenn man, wie in diesem Fall, nur sich selber und nicht andere gefährdet, finde ich in den seltensten Fällen gerechtfertigt.
Doch diese Vorschrift überrascht mich nicht. Entgegen seinem Ruf vom lockeren und übercoolen Land, in dem fast alles geht, sind die Regeln in Australien ziemlich hart, sei es im Strassenverkehr, oder anderswo. Doch darauf, was ich gestern gesehen habe, bereitete mich auch diese kleine Episode mit dem Helm nicht vor.

Am Strand von Bondi Beach gibt es ein neues Verbotsschild, dass darauf aufmerksam macht, dass hier Joggen ohne Helm nicht erlaubt sei. No helmet = No run – steht dort drauf. Wer dagegen verstösst, dem wird eine Strafe angedroht.
Ach was, das kann doch nicht sein. Kopfschüttelnd stehen die Menschen vor dem Schild. “Fast so unsinnig wie das Einreiseverbot in Amerika”, sagt einer. Doch leider ist Trump’s Einreiseverbot Tatsache, während sich nach ein wenig Recherche herausstellt, dass das Schild mit der Helmpflicht ein Scherz eines Unbekannten ist.